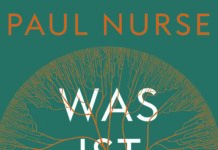Die serielle Endosymbiontentheorie (EST) ist nicht Margulis´ originäre Entdeckung, sondern geht auf den Botaniker Andreas Schimper (1856-1901) zurück, der im Jahr 1883 bereits eine ähnliche Hypothese aufstellte. Der russische Biologe Konstantin Sergejewitsch Mereschkowski (1855-1921) griff diese Idee Anfang des 20. Jahrhunderts erneut auf, aber beiden war es nicht gelungen, stichhaltige Beweise für diese Theorie zu liefern, die bei der damaligen scientific community durchgehend auf Ablehnung stieß.
So bleibt es schließlich das Verdienst der 2011 verstorbenen Biologin, diese Theorie durch eine Vielzahl von Untersuchungen, insbesondere durch Sequenzvergleiche von Genen und Proteinen, gestützt und populär gemacht zu haben. Dabei musste die streitbare Wissenschaftlerin, und erste Ehefrau des berühmten Astrophysikers und Fernsehmoderators Carl Sagan, lange kämpfen, bevor die EST Eingang in die Lehrbücher der Biologie fand. Und auch wenn noch längst nicht alle Fragen geklärt sind, ist die EST mittlerweile ein fester und wichtiger Bestandteil der Evolutionstheorie.
Die meisten Neuerungen der Evolution sollen durch Symbiose entstanden sein
Die zentrale Aussage der EST, deren Geschichte die Autorin teils aus sehr persönlicher Sicht erzählt, lautet, dass vor zirka zwei Milliarden Jahren prokariotische Zellen, das heißt Zellen ohne Zellkern, durch Symbiogenese den ersten Eukaryoten (mit Zellkern) hervorgebracht haben. Im Speziellen die Organellen, wie Mitochondrien und Plastiden, aber auch die Schwimmorganellen, so wie die meisten Neuerungen der Evolution, sollen demnach durch Symbiose entstanden sein, da ihre Gene noch viele Eigenschaften freilebender Bakterien tragen. Die Symbiogenese ist, so die Autorin, „der Faktor, der alle kernhaltigen Zellen von den bakteriellen Lebensformen unterscheidet. Dazwischen gibt es nichts – eine Gruppe von Lebewesen ist entweder durch Symbiogenese entstanden oder nicht.“
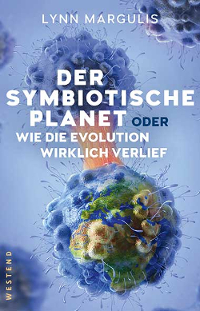
Diese Sicht auf die Entstehung von Zellen war und ist nicht zuletzt deshalb revolutionär, weil sie dem Darwinschen Dogma vom ewigen Kampf ums Überleben die Kooperation entgegenstellt. Ein Faktor der bei der Entwicklung und mit Sicherheit auch bei der Entstehung des Lebens, wie auch bei der Entstehung komplexer Zellen, eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt hat.
Hier zeigt sich auch die Nähe der EST zur sogenannten Gaia-Theorie des englischen Biophysikers James Lovelock, auf die Margulis im letzten Teil des Buches eingeht. Nach Lovelocks Definition ist Gaia das Lebenssystem der ganzen Erde. Es ist ein evolvierender, in Interdependenz mit allem Lebendigen stehender Organismus. Was Gaia, wie alle lebenden Organismen, dabei auszeichnet, ist ihre Fähigkeit zur Homöostase, das heißt, die Fähigkeit für ein chemisch und physikalisch stabiles Milieu zu sorgen. Die Autorin geht sogar noch weiter und bezeichnet Gaia als „in allen ihren Zellen, Körpern und Gesellschaften in unterschiedlichem Maße wahrnehmungsfähig und bewusst.“ Für eine Wissenschaftlerin ist das eine bemerkenswerte Aussage, die selbst wissenschaftlich nicht mehr begründet werden kann. Was die beiden Theorien verbindet, ist eben die Überzeugung, dass Leben nicht ausschließlich im Darwinschen Kampf ums Überleben, sondern vielmehr in Kooperation und gegenseitiger Abhängigkeit besteht. So sind wir der Autorin zufolge „symbiontische Wesen auf einem symbiontischen Planeten.“
Darwin hatte dem Leben in seiner Konzeption der „natürlichen Auslese“ eine eher passive Rolle zugedacht, indem der den Organismen jegliches zielorientiertes Handeln absprach. Nach Margulis und Lovelock ist das Leben dagegen äußerst aktiv und schafft sich seine perfekte Umgebung fortwährend selbst, und das nicht nur auf individueller, sondern auch auf globaler Ebene. Mehr noch scheint das Leben teleologisch verfasst zu sein, denn „die Gesetzmäßigkeiten von Gaia [sind] scheinbar geplant, aber sie treten ohne einen zentralen ‚Kopf‘ oder ein ‚Gehirn‘ auf.“
Margulis fehlt eine überzeugende Anthropologie
Der Mensch stellt für Margulis dabei keine Besonderheit dar, sondern ist auch nur ein Teil des lebendigen Ganzen und somit auch abhängig von den anderen Lebewesen. „Sie verwerten unsere Stoffe und liefern uns Wasser und Nahrung. Ohne ‚die anderen‘ können wir nicht überleben.“ Eigentlich eine Binsenweisheit und doch handeln wir so, als ob es nicht so wäre. In diesem Zusammenhang ist Margulis der Meinung, dass der Mensch nichts weiter sei als ein komplexeres Tier und übersieht, bei allen Gemeinsamkeiten, seine grundlegende Andersartigkeit. Denn, so hat es der Schweizer Biologe Adolf Portmann formuliert, „mit der Verwirklichung der menschlichen Daseinsweise ist nicht einfach eine komplizierte Säugerart mehr entstanden, sondern eine gänzlich neue Lebensform, eine neue Stufe des Seienden, höher als die tierische im Rang ihrer Innerlichkeit, also ihres Welterlebens und ihrer Wirkungsmacht.“ Ihr fehlt hier somit, wie so vielen WissenschaftlerInnen, eine überzeugende Anthropologie und damit auch eine angemessene ontologische Konzeption des Menschen. Das ist umso erstaunlicher, da sie selbst in ihrer Gaia-Konzeption einen spiritualistischen Ansatz zu vertreten scheint.
Der Mensch ist eben nicht nur ein biologisches, sondern vor allem auch ein geistiges Wesen, das nicht nur Welt ist, sondern Welt hat und sich nicht zuletzt aufgrund dieser Tatsache in einen Gegensatz zur in sich geschlossenen Natur gestellt sieht. Diesem Gegensatz ist auch seine Hybris geschuldet und die Autorin macht sich vielleicht zurecht über die Anmaßung der Menschen lustig, „Verantwortung für die lebende Erde zu übernehmen“. Für sie ist das „die Rhetorik der Machtlosen“, denn „unser Planet sorgt für uns, nicht wir für ihn. Unser aufgeblasenes moralisches Gebot, eine widerspenstige Erde zu zähmen oder unseren kranken Planeten zu heilen, zeigt nur unsere maßlose Fähigkeit zur Selbsttäuschung. In Wirklichkeit müssen wir uns vor uns selbst schützen.“ Das ist natürlich nur allzu wahr, könnte aber auch als Freibrief (miss)verstanden werden, mit dieser Erde weiter so zerstörerisch umzugehen, wie wir es bisher getan haben.
Zur Frage der Lebensentstehung selbst kann und will diese Theorie naturgemäß nichts beitragen und auch Margulis weiß, dass „der Ursprung des Lebens eine mystische Vorstellung ist – nicht in dem Sinn, dass es ihn nicht gegeben hätte, sondern weil er an ein tiefgreifendes Gefühl des Geheimnisvollen rührt.“ Auch das klingt wenig wissenschaftlich, macht die Autorin aber gerade deshalb sympathisch, da sie nicht vorgibt, irgendetwas Gehaltvolles über die Ursprünge des Lebens sagen zu können.
Das Buch ist im Übrigen eine unveränderte Neuauflage des Buches Die andere Evolution, das 1999 im Spektrum Verlag erschienen ist. Für alle, die an einer relativ lockeren und mit persönlichen Geschichten angereicherten Darstellung der Endosymbiontentheorie interessiert sind, ist das ein durchaus lesenswertes und informatives Buch. Da sich, im Gegensatz zu anderen Bereichen der Biologie, der Fortschritt in diesem Bereich in Grenzen hält, ist eine Neuauflage eines zwanzig Jahre alten wissenschaftlichen Buches durchaus gerechtfertigt, da ohnehin nur sehr wenige lesbare Bücher zu diesem Thema zu haben sind.
Lynn Margulis: Der symbiotische Planet oder wie die Evolution wirklich verlief. Westend Verlag, Frankfurt 2018. 188 Seiten, 20 Euro