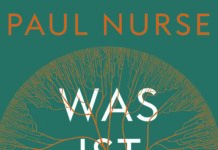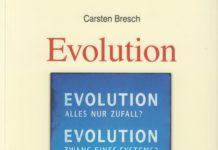Ein Buch über Bewusstsein zu besprechen ist eine undankbare Aufgabe. Das liegt vor allem an der schlichten Tatsache, dass weder der Autor noch der Rezensent weiß, was Bewusstsein eigentlich ist. Aus diesem Grund sehen sich einige WissenschaftlerInnen oftmals dazu genötigt, immer detailreicher zu beschreiben, was sich in bestimmten Gehirnarealen abspielt, um zumindest den Anschein zu erwecken, etwas Substanzielles zum Thema beisteuern zu können. Im vorliegenden Fall klingt das dann so: »Das Gefälle wird bestimmt von Bottom-up-Inputs an den präfrontalen Cortex. Die eher posterioren Areale des präfrontalen Cortex erhalten zunächst Informationen von unimodalen sekundären Sinnesarealen. Dazwischen liegende Regionen wie der dorsal laterale und der ventral laterale präfrontale Cortex empfangen kombinierten unimodalen und multimodalen Input; diese Bereiche üben Top-Down Kontrolle auf ihren posterioren Input aus. Der Frontalpol, die vorderste Region, erhält lediglich Informationen aus multimodalen Konvergenzzonen und erstellt die abstraktesten konzeptuellen Repräsentationen im Gehirn.« Und so geht das über viele Seiten weiter, wobei sich der entsprechende Erkenntnisgewinn zunehmend gegen Null bewegt.
LeDoux kann nur beschreiben, was er gerne erklären würde
Denn was sich überhaupt wissenschaftlich untersuchen lässt, ist eben lediglich das neurophysiologische Korrelat gewisser Bewusstseinszustände, niemals das Bewusstsein selbst. Und spätestens bei den sogenannten Qualia gibt es noch nicht einmal eine Idee, wie sich diese subjektiven Erlebnisse mentaler Zustände erklären ließen. Sie sind, so hat es der australische Philosoph David Chalmers einmal formuliert, »the hard problems of consciousness.« Und selbst die »astronomische Kenntnis des Gehirnes, die höchste, die wir davon erlangen können, enthüllt uns darin nichts als bewegte Materie. Durch keine zu ersinnende Anordnung oder Bewegung materieller Theilchen [sic] aber lässt sich eine Brücke in’s Reich des Bewusstseins schlagen.« Diese Sätze des deutschen Physiologen Emil Du Bois-Reymond aus seinem berühmten Vortrag Über die Grenzen des Naturerkennens sind heute noch so aktuell wie zur Zeit ihrer Äußerung vor ziemlich genau einhundertfünfzig Jahren.
Somit sind die AutorInnen der entsprechenden Bücher dazu verdammt, lediglich zu beschreiben, was sie doch eigentlich gerne erklären würden. Erklärungen durch Beschreibungen zu ersetzen ist ohnehin ein weit verbreitetes Phänomen. Auch das kann zweifellos sehr interessant sein, führt aber schon nach kurzer Zeit zu einer gewissen Ermüdung. Denn es bringt den Lesenden bei der Frage, was Bewusstsein ist, eben um keinen Millimeter weiter, wenn er erfährt in welchem Hirnareal gerade ein Prozess abläuft, von dem aber auch nicht bekannt ist, in welchem Zusammenhang er jetzt genau zu der beobachteten Handlung bzw. dem introspektiv erfahrenen Phänomen steht.
Leider bedient sich LeDoux bei der Beschreibung des Gehirns einer Terminologie, die eher auf einen IT-Fachmann schließen lässt als auf einen Neurowissenschaftler. Da ist von Schaltkreisen die Rede, von Rechenleistung und Hardware. Doch eine derartige aus der Computertechnik entlehnte Sprache ist am wenigsten dazu geeignet, etwas Konstruktives zur Erklärung des Bewusstseins beizutragen. Das Gehirn ist eben kein Computer und weder kognitive Prozesse im Allgemeinen noch das Bewusstsein im Speziellen lassen sich auf das Verrechnen von Einsen und Nullen reduzieren. Lebewesen, und somit auch die Menschen, als komplexe Maschinen zu verstehen ist ein unseliges Erbe der Renaissance und leider bis heute nicht aus den Köpfen vieler WissenschaftlerInnen zu tilgen. Aus diesem Grund hängen noch immer einige dem Irrglauben an, Computer könnten eines Tages so etwas wie Bewusstsein entwickeln. Und ein paar durchgeknallte Transhumanisten glauben allen Ernstes, ihr Bewusstsein eines Tages auf einen Computer hochladen zu können, um sich auf diese Weise unsterblich zu machen.
Kognition als Folge einer speziellen Mutation?

Schade ist auch, dass für den Autor alles unter der Forderung des Überlebenskampfes und der Anpassung steht. Auch die Autonoesis (das Selbstbewusstsein) muss natürlich »einen bedeutenden überlebenssichernden Vorteil mitgebracht haben – andernfalls wäre sie als ein evolutionärer Ausrutscher eliminiert worden.« Mittlerweile ist die Biologie aber weiter und hat vielfach gezeigt, dass vor allem Kooperation das zentrale Movens der Evolution darstellt. Und auch dem wichtigen Begriff der Anpassung muss der wohl noch entscheidendere der Abgrenzung zur Seite gestellt werden, denn erst diese hat Leben überhaupt erst möglich gemacht.
Kognition ist für LeDoux ohnehin nichts anderes als die Folge einer speziellen Mutation, die abstraktes Denken und Sprache ermöglichte, und Bewusstsein lediglich ein »nachträglicher Einfall der Evolution.« Das ist im Übrigen ein interessanter Satz, denn wem fällt hier etwas ein? Der Evolution? Merkwürdig genug! Aber setzt nicht die Fähigkeit, einen Einfall haben zu können bereits Geistigkeit voraus? Und die Vorstellung, dass das Mentale Ergebnis einer zufällig stattgefundenen Mutation sein soll, ist genauso abwegig wie die Annahme, es wäre nichts anderes als das Epiphänomen irgendwelcher materiellen Prozesse. Genau umgekehrt wird es richtig. Geistigkeit war von Beginn an eine fundamentale oder besser noch primordiale Eigenschaft der Welt, das was Platon ψυχή τοῦ παντός (die Weltseele) nannte, und hat sich im Laufe der Evolution immer sichtbarer manifestiert, zuletzt im autonoetischen Bewusstsein des Menschen.
Gefühle sind LeDoux zufolge an menschliches Selbstbewusstsein gekoppelt
Am schwersten nachzuvollziehen ist aber die Behauptung des Autors, Emotionen hätten sich erst mit dem menschlichen Selbstbewusstsein entwickelt. Für LeDoux sind Emotionen »autonoetische bewusste Erfahrungen, die kognitiv zusammengesetzt werden, ähnlich wie anderes autonoetisches Erleben.« Da das Selbstbewusstsein, so LeDoux erst mit dem Menschen in die Welt gekommen ist, wären Gefühle demnach »eine Spezialisierung des Menschen und nur durch die einzigartigen Fähigkeiten unseres Gehirns möglich.« Dass »Handlungen und physiologische Reaktionen [bei anderen Lebewesen, EL], die unsere Gemütszustände widerspiegeln, durch ebendiese Gefühle verursacht werden«, nennt LeDoux eine »archaische« Vorstellung.
Sein Kollege, der portugiesische Neurowissenschaftler António Damásio, hat dagegen richtig erkannt, dass Gefühle ein Fundament des Lebens und des Bewusstseins sind: »Denn das gesamte Gewebe des bewussten Geistes ist aus dem gleichen Stoff gemacht: aus Bildern, die durch die Kartierungsfähigkeiten des Gehirns entstehen. […] Sie werden von Anfang an spontan und ganz natürlich gefühlt, bevor irgendeine andere am Aufbau des Bewusstseins beteiligte Tätigkeit abläuft. Es sind gefühlte Bilder des Körpers, ursprüngliche Körpergefühle, die Urbilder aller anderen Gefühle, einschließlich der Gefühle von Emotionen.« Das ist zwar mit Sicherheit noch lange nicht die ganze Wahrheit, kommt ihr aber schon erheblich näher.
Folgt man LeDouxs Argumentation, so würde das Schreien eines gequälten Tieres noch lange nicht bedeuten, dass es wirklich Schmerzen hat. Vielleicht ist es ja, um der Maschinenmetapher treu zu bleiben, in Wahrheit nichts anderes als das Quietschen eines Rades. So hatte es sich der französische Philosoph René Descartes gedacht. Es ist, neben anderen Fehleinschätzungen, genau diese Auffassung, die es vermeintlich rechtfertigt, Tiere in Versuchslaboren zu quälen und sie in Mastbetrieben unter unwürdigen Bedingungen zu halten. Auch wenn sich LeDoux dagegen ausspricht, Tiere zu foltern oder zu misshandeln, scheint das nicht viel mehr zu sein als ein Lippenbekenntnis, denn aus seiner wissenschaftlichen Sicht lässt sich kaum begründen, warum wir in der Behandlung von Tieren ohne autonoetisches Bewusstsein irgendwelche Skrupel haben sollten. Es wird höchste Zeit, dieses in Wahrheit archaische Denken zu überwinden und Tiere endlich als gleichwertige Mitgeschöpfe anzuerkennen. Abgesehen davon ist es ohnehin kein überzeugendes Konzept, die Rechte der Tiere an ihre Schmerzfähigkeit zu binden, wie es die pathozentrische Ethik tut.
LeDoux ist der Meinung, dass wir nicht wissen, was andere Tiere empfinden. Das ist zweifellos richtig. Wir wissen ja noch nicht einmal, was andere Menschen empfinden. Aber unsere Fähigkeit, mit anderen Lebewesen zu fühlen, zeigt, dass es eine Verbindung zwischen allem Lebendigen gibt, die über bloßes Wissen hinausreicht. Man nennt das Empathie! Der chinesische Philosoph und Dichter Tschuang-tse hat bereits im vierten vorchristlichen Jahrhundert eindrucksvoll und sehr überzeugend beschrieben, was das bedeutet:
Tschuang-tse lustwandelte einst mit seinem Freunde Hui-tse auf einer Brücke. Tschuang-tse sprach: »Wie munter springen und tummeln sich die flinken Fische! Das ist die Freude der Fische.« Hui-tse sprach: »Du bist kein Fisch, wie kannst Du da der Fische Freuden kennen?« Tschuang-tse sprach: »Du bist nicht ich, wie kannst Du wissen, ob ich nicht doch der Fische Freuden kenne?« Hui-tse sprach: »Ich bin nicht du, und darum kann ich dich allerdings nicht völlig kennen. Aber fest steht, daß du kein Fisch bist, und damit ist vollkommen klar, daß du der Fische Freuden nicht kennen kannst.« Tschuang-tse sprach: »Bitte, laß uns zum Ausgangspunkt zurückkehren! Du sagtest: ›Wie kannst Du denn der Fische Freuden kennen?‹ Du wußtest dabei schon im voraus, ob ich sie kenne, und fragtest doch. Ich kenne der Fische Freuden aus meiner Freude, ihnen von der Brücke aus zuzusehen!«
LeDoux wendet sich vehement gegen jede Form des Anthropomorphismus
Doch der vielleicht irritierendste Satz findet sich auf Seite 400, wenn LeDoux schreibt: »Die romantische Vorstellung, andere Säugetiere seien so etwas wie pelzige, primitive Menschen, die mit allen menschlichen psychologischen Eigenschaften ausgestattet sind […], ist intuitiv bezwingend und funktioniert im täglichen Umgang mit unseren Haustieren recht gut. Als wissenschaftlichen Ansatz halte ich diese Vorstellung jedoch für verfehlt.« Er wendet sich damit gegen einen Anthropomorphismus, der versucht, menschliche Eigenschaften und Gefühle auf Tiere zu übertragen. Damit hat er bis zu einem gewissen Grad Recht, denn natürlich sind andere Säugetiere keine primitiven Menschen. Aber unsere Gefühle sind das vorläufige Endergebnis einer zirka vier Milliarden Jahre dauernden Entwicklung, die auch die Tiere und ihre Emotionen hervorgebracht hat. Wir übertragen somit unsere menschlichen Gefühle nicht auf die Tiere, sondern erkennen unsere eigenen in ihnen wieder. LeDoux ignoriert die simple Tatsache, dass grundsätzlich alle Lebewesen bereits über Subjektivität, und damit Innerlichkeit, verfügen und Emotionen das sind, »was die körperlichen Prozesse für das Subjekt bedeuten. Im Gefühl übersetzt sich das Unbewusste des Stoffwechsels in innere Empfindung, in etwas, das mit mir geschieht.« (Andreas Weber)
LeDoux spürt ja offensichtlich und sogar »intuitiv bezwingend«, dass Tiere Gefühle haben und wir mit ihnen emotional verbunden sind. Aber es kann eben nicht sein, was seiner Theorie zufolge wissenschaftlich nicht sein darf. Seiner Intuition und seinen Gefühlen im Umgang mit anderen Lebewesen derart zu misstrauen, ist aber ein erster Schritt in die Barbarei. Der Hirnforscher Wolf Singer sagte einmal in einem Interview, dass Forscher besser erklären müssen, »welchen Nutzen und Erkenntnisgewinn Tierversuche versprechen. Nur so kann dem Problem begegnet werden, dass Menschen, die keine Experten sind, den emotionalen Kampagnen der Tierversuchsgegner erliegen. Wir alle sind durch emotionale Argumentationen verführbar, aber wenn uns Hintergründe und Motive genügend differenziert dargelegt werden, verringert sich die Gefahr, uns durch Propaganda verführen zu lassen.« Hier sollen wir mit der gleichen Argumentation dazu gebracht werden, unsere Gefühle von uns abzuspalten und unser Mitleid mit gequälten Tieren durch Rationalisierung zu überwinden. Das ist exakt die Einstellung, mit der man auch ein KZ leiten könnte.
Wir werden es niemals wissen
Das alles sind gravierende Einwände und doch hat LeDoux, zumindest auf den ersten zweihundertfünfzig Seiten, eine fachlich fundierte und gut nachvollziehbare Darstellung der Evolution geschrieben, die allerdings darunter leidet, einige wichtige Erkenntnisse der modernen Evolutionsforschung zu ignorieren. Leider verliert er sich am Ende über weite Strecken in neurowissenschaftlichen Details, die nur noch wenig zum Verstehen des Themas beitragen. Seine zentrale These der späten Entwicklung der Emotionen, die er als »kognitiv zusammengesetzt« beschreibt, hält einer näheren Untersuchung nicht stand und lässt einen Großteil der Lebewesen als stumpfe emotionslose Geschöpfe erscheinen.
Was Bewusstsein ist, bleibt dabei naturgemäß völlig ungeklärt. Das war nicht anders zu erwarten und hängt nicht zuletzt mit dem Umstand zusammen, dass wir den ontologischen Status von Materie nicht kennen. Verfügt sie möglicherweise bereits selbst über protomentale Eigenschaften? Aber selbst dieses Wissen würde uns bei der Frage danach, was Bewusstsein ist, wahrscheinlich nicht weiterbringen, sondern das Problem lediglich auf eine andere Ebene verlagern. Du Bois-Reymond war im Übrigen skeptisch, was die Beantwortung der Frage nach dem Wesen des Bewusstseins betrifft und beendete seinen Vortrag seinerzeit mit dem Wort »ignorabimus«. Wir werden es niemals wissen.
Joseph LeDoux: Bewusstsein. Die ersten vier Milliarden Jahre. Klett-Cotta Verlag, 2021. ISBN-13: 978-3-608-98331-9