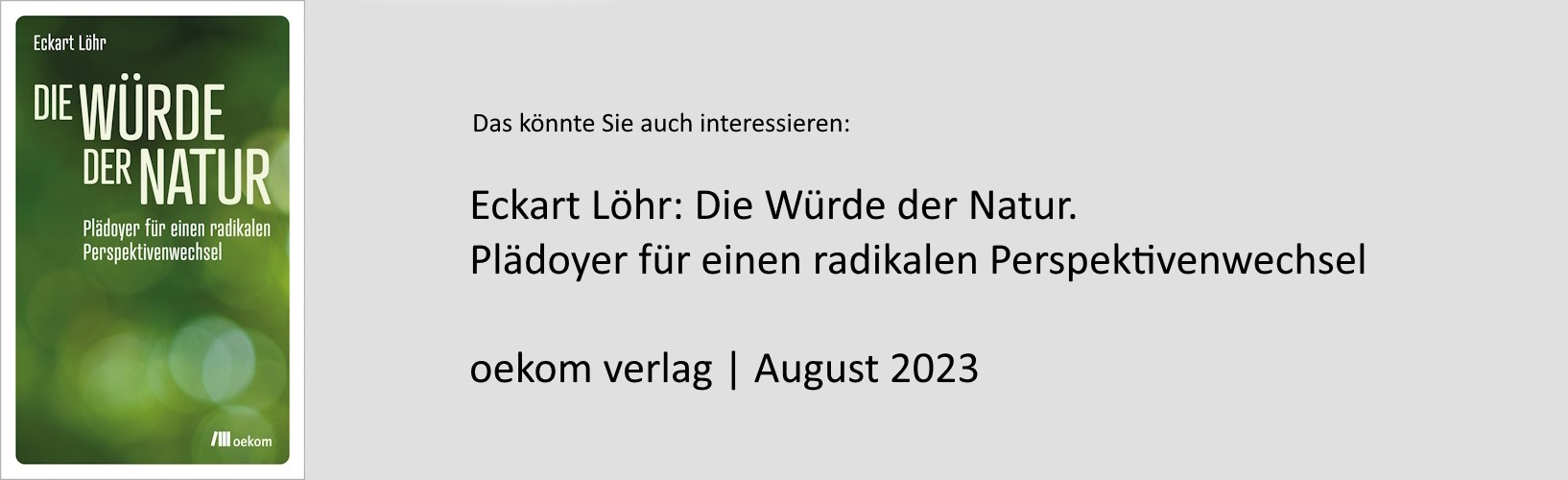Wir zerstören die Lebensgrundlagen unseres Planeten mittlerweile in einem Tempo und Ausmaß, das man nur noch als apokalyptisch bezeichnen kann. Und weil der Mensch, nicht zuletzt aufgrund seiner Destruktivität, zum zentralen Einflussfaktor auf dem Planeten Erde geworden ist, leben wir jetzt im Zeitalter des Anthropozäns.
Wir wissen alle, dass wir so nicht weitermachen können und sind dessen ungeachtet offensichtlich fest dazu entschlossen, den einmal eingeschlagenen Weg in den Untergang bis zum bitteren Ende zu gehen. Wer glaubt, dass nach der sogenannten Corona-Krise eine neue Zeit der Demut, Bescheidenheit oder des Verzichts anbricht, ist entweder dumm, ideologisch motiviert oder grenzenlos naiv. Das Gegenteil wird eintreten. Der gerade ins Stottern geratene Motor der kapitalistischen Megamaschine wird noch einmal bis in den roten Drehzahlbereich hochgejagt, um die bisher eingetretenen Verluste zu kompensieren. Noch besser: zu überkompensieren, um dann ungebremst gegen die Wand der endlichen Ressourcen und der totalen ökologischen Katastrophe zu fahren.
Der englische Philosoph Bertrand Russell hat sich bereits vor über siebzig Jahren gefragt, »wie man die Menschheit überreden kann, in ihr eigenes Überleben einzuwilligen?« Die Frage stellt sich heute so dringlich, wie wohl noch nie in der Geschichte des Homo sapiens – wobei das Epitheton zunehmend fragwürdig geworden ist – und kann auch nur noch global beantwortet werden. Doch diese Antwort wollen wir, trotz der nicht mehr zu leugnenden Kollateralschäden unseres Lifestyles, nicht geben. Denn noch läuft es für einen, wenn auch vergleichsweise kleinen Teil der Menschheit, ganz gut. Auch das wird sich schon sehr bald ändern. Insofern kann es nicht schaden, noch einmal die wichtigsten Motive zu nennen, diese Erde auch in Zukunft für uns und andere Lebewesen bewohnbar zu halten.
Was könnte uns, neben der Sorge um das eigene Überleben, motivieren, unseren zerstörerischen Weg zu verlassen? Vielleicht die Tatsache, dass es etwas gibt, das größer ist als wir selbst. Doch dass etwas größer sein könnte als der Mensch, ist wahrscheinlich für die meisten von uns kaum mehr vorstellbar. Und diese mangelnde Demut ist nicht zuletzt eine der Hauptursachen für unsere Zerstörungswut. Aber es gibt etwas, das größer ist als wir: Das ist zum einen die Natur und zum anderen das, was wir in der Regel als Gott bezeichnen. Und so kann sich auch niemand aufgrund seiner weltanschaulichen Position aus der Affäre ziehen, da es sowohl für die Atheistin als auch für den Gläubigen gute Gründe gibt, neben dem (offensichtlich verlorengegangenen) Interesse an Selbsterhaltung, die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten zu bewahren. Auf der Ebene der Natur finden sich diese Gründe in der Umweltethik sowie der Evolutionstheorie. Auf der Ebene Gottes, wenn man das so sagen kann, in der Metaphysik beziehungsweise der Religion.
Alle Lebewesen verfügen über intrinsischen Wert
Lange Zeit galt nur der Mensch als Träger moralischer Rechte und selbst das musste hart erkämpft werden. Denn erst einmal war die Bezeichnung Mensch das Synonym des reichen Mannes. Denn schon die Frauen hatten bedeutend weniger Rechte, die Kinder noch weniger und die Sklaven so gut wie gar keine. Dass Menschen heute unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Geschlecht in fast allen Ländern der Welt zumindest theoretisch die gleichen Rechte haben, ist eine enorme Errungenschaft der Moderne. Dass die Praxis, wie ein Blick nach Amerika gerade wieder zeigt, oftmals eine andere ist, verdeutlicht nur, dass wir nie wirklich in dieser Moderne angekommen sind.
Erst langsam erweiterte sich der Raum der Rechte auch auf die anders-als-menschliche Welt und umfasst heute im Rahmen einer pathozentrischen Ethik bereits einen Teil der Tiere. Hier wird allerdings noch immer eine künstliche Grenze gezogen für die Fähigkeit, Träger moralischer Rechte zu sein und diese an die Leidensfähigkeit des betreffenden Tieres gekoppelt. Die sogenannte holistische Ethik, die allein die einzig überzeugende Ethik des 21. Jahrhunderts sein kann, hat diesen Rechtsraum konsequent auf alles Lebendige und darüber hinaus auch auf Flüsse, Berge oder ganze Ökosysteme ausgedehnt. Diese Ethik geht davon aus, dass alles Lebendige nicht für uns und unser Wohlergehen da ist, sondern um seiner selbst willen. Aus dieser Sicht sind es auch nicht wir, die den Wert der Lebewesen festlegen. Jedes einzelne von ihnen verfügt über einen eigenen, intrinsischen und damit von uns unabhängigen Wert. Die Würde der Lebewesen beruht dabei nicht zuletzt auf der schlichten Tatsache, dass sie, so wie wir auch, über Innerlichkeit und Subjektivität verfügen. »Leben ist« so hat es der Biologe und Philosoph Andreas Weber ausgedrückt, »das Erscheinen eines Wertes, der Körper geworden ist.«
Leider ist es immer noch so, dass in vielen Umweltdebatten von den Beteiligten in der Regel eine anthropozentrische Position vertreten wird. Die Natur soll nicht um ihrer selbst willen erhalten werden, sondern aus dem einfachen Grund, weil wir fundamental auf sie angewiesen und von ihr abhängig sind. Wenn man aber anerkennt, dass alles Lebendige Wert und Würde besitzt, ist damit unweigerlich der moralische Auftrag verbunden, die Natur um ihrer selbst willen zu bewahren und zu schützen wo immer es in unserer Macht steht. Sie unter Missachtung ihrer Würde für unsere Zwecke zu manipulieren, auszubeuten oder gänzlich zu zerstören ist moralisch in keiner Weise zu rechtfertigen.
Wir sind nicht das Ende der Evolution
Der Mensch und mit ihm alle anderen Lebewesen sind das Ergebnis einer Entwicklung, die vor zirka vier Milliarden Jahren auf dieser Erde begonnen hat. In dieser ungeheuren Zeitspanne hat die Natur immer komplexere Lebensformen hervorgebracht. Mit dem Menschen zuletzt sogar ein Lebewesen, das über die bemerkenswerte und nicht zu erklärende Fähigkeit verfügt, in Freiheit sich selbst und sein eigenes Denken zum Gegenstand seiner Betrachtung zu machen. Auch wenn noch immer viele Menschen glauben, wir wären der Endpunkt dieses geschichtlichen Prozesses, besteht zumindest die Möglichkeit, dass dem nicht so ist. Wir müssen in Betracht ziehen, dass diese Entwicklung nicht mit uns zum Stillstand gekommen ist, sondern weitergehen und letztlich auch über uns hinausführen wird. Denn dass dieser evolutive Prozess hier und heute an sein Ende gekommen sein soll, scheint doch eher unwahrscheinlich zu sein.
Wenn aber die Entwicklung des Lebens nicht aufhört und es sich auch in Zukunft in immer neuen Formen ausdrücken wird und ausdrücken möchte, dürfen wir diese Entwicklung nicht behindern oder gar beenden. Niemand erwartet von uns, irgendwelche Wunder zu vollbringen, sondern nur das eigentlich Selbstverständliche: die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten nicht zu zerstören. Man könnte das schlicht als ethische Minimalforderung bezeichnen. Wir haben nicht das Recht, diese vier Milliarden Jahre alte lückenlose Kette des Seins an dieser Stelle, hier und heute, zu zerreißen. Es wäre die Anerkennung der schlichten Tatsache, dass auch wir selbst lediglich ein Produkt dieser Jahrmilliarden dauernden evolutiven Geschichte sind. Es wäre ein Standpunkt der Demut, sich einzugestehen, dass da etwas größer ist als wir und wir deshalb nicht das Recht haben, in diesen Ablauf, dessen Sinn und dessen Ursache wir nicht kennen, einzugreifen. Dass wir schon jeden Tag unwiderruflich in diesen Ablauf eingreifen und so zu einer der Hauptursachen des sechsten globalen Artensterbens geworden sind, bleibt unsere unauflösliche Schuld.
Wir können nicht ausschließen, dass die Welt Gottes Schöpfung ist
Ein weiteres und vielleicht das zentrale Motiv, diese Welt und alles Leben auf ihr zu erhalten, erfordert etwas, was in unserer durch und durch säkularen Gesellschaft nur noch schwer zu vermitteln ist: Glauben. Denn so wie wir nicht wissen, welchen Weg die Evolution nehmen wird, so wissen wir auch nicht, wie diese Welt entstand und können zumindest nicht ausschließen, dass sie die Schöpfung Gottes ist. Das aber setzt einen Akt des Glaubens voraus, der nicht weiter hinterfragt werden kann. Wenn es aber so ist, wäre diese Welt in gewisser Weise heilig. Somit könnten wir auch nicht ausschließen, dass sie teleologisch, um nicht zu sagen eschatologisch, verfasst ist. Das heißt, sie hätte ihren eigenen Sinn und ihr eigenes Ziel und vielleicht ihre eigene Erlösung.
So wie diese Welt dann als Ganzes heilig wäre, so wäre es auch das Leben. Denn wir kennen weder seine Herkunft, noch wissen wir, was es seinem Wesen nach ist. Daraus resultiert auch das Gebot, es nicht zu zerstören. Denn weil wir nicht wissen, was Leben ist, können wir es auch nicht wiederherstellen, wenn wir es einmal zerstört haben. Das ist der fundamentale Unterschied zu den von Menschen gemachten Dingen, die sich im Falle ihrer Zerstörung reparieren lassen. Abgesehen davon war die Natur vor uns da, hat sozusagen die älteren Rechte, und »wer von uns weiß, was das andere Lebewesen an sich und in dem Weltganzen für eine Bedeutung hat?“ So hat es der Arzt und Theologe Albert Schweitzer formuliert.
Wir kennen also weder den Ursprung der Welt noch unseren eigenen. Darüber hinaus haben wir keine Idee vom Wesen des Lebens und somit keine Idee von dem was wir selbst sind. Dass wir auf diese zentralen und Jahrtausende alten Fragen keine Antworten haben und die Welt letztlich nicht aus sich selbst heraus erklärbar ist, scheint ein starker Hinweis auf den numinosen Urgrund allen Seins zu sein. Somit käme die Zerstörung dieser Welt, einem Angriff auf diejenige Macht gleich, die diese Welt geschaffen hat. Es wäre das ultimative Verbrechen und in Wahrheit verüben wir es bereits jeden Tag.
Der Mensch als Mitschöpfer in einer unvollkommenen Welt
Doch wenn diese Welt Gottes Schöpfung ist, so kann sie unmöglich schon vollendet sein. Das Dasein des Menschen ist hierfür der schlagende Beweis. Durch seine spezielle ontologische Verfasstheit, das nicht festgestellte Tier zu sein (Friedrich Nietzsche), ist er sozusagen vor Gott in die Verantwortung gerufen, als Mitschöpfer an dieser Welt zu arbeiten. An dieser Welt zu arbeiten heißt vor allem, sie besser und lebendiger zu machen, wo immer uns das möglich ist. An dieser Welt arbeiten heißt auch, zu versuchen die Kluft, die uns von ihr trennt, in tätiger Liebe zu überbrücken. Von der spanischen Mystikerin Theresa von Avila stammt der Satz, dass Gott keine anderen Hände hat als unsere. Sollten wir demnach die Erde in eine solche Extremsituation bringen, dass sie uns eines Tages einfach abschüttelt, so würde Gott mit unserem Verschwinden auch einen Teil seiner Möglichkeiten verlieren.
Und noch einmal: Wir wissen nicht warum wir hier sind, welchen Sinn das alles hat und was wir unserem Wesen nach sind. Nur manchmal beschleicht uns eine Ahnung, dass es etwas Großes sein könnte. Auch wenn wir nicht sicher sagen können, dass es so ist, verpflichtet uns die bloße Möglichkeit, dass es so sein könnte zu einer radikalen Umkehr auf unserem Weg in die Selbstzerstörung. Es wäre im einfachsten Fall eine Philosophie des Als-Ob mit Gott als regulativer Idee, die sogar für den Agnostiker akzeptabel wäre. Denn wie sich herausgestellt hat, verfügt alles Sein nicht nur über eine innere, sondern auch über eine metaphysische Dimension, wobei diese beiden Dimensionen in Wahrheit identisch sind. Das zu erkennen und danach zu handeln wird nicht zuletzt über unsere Zukunft entscheiden.
(Foto: iStock)