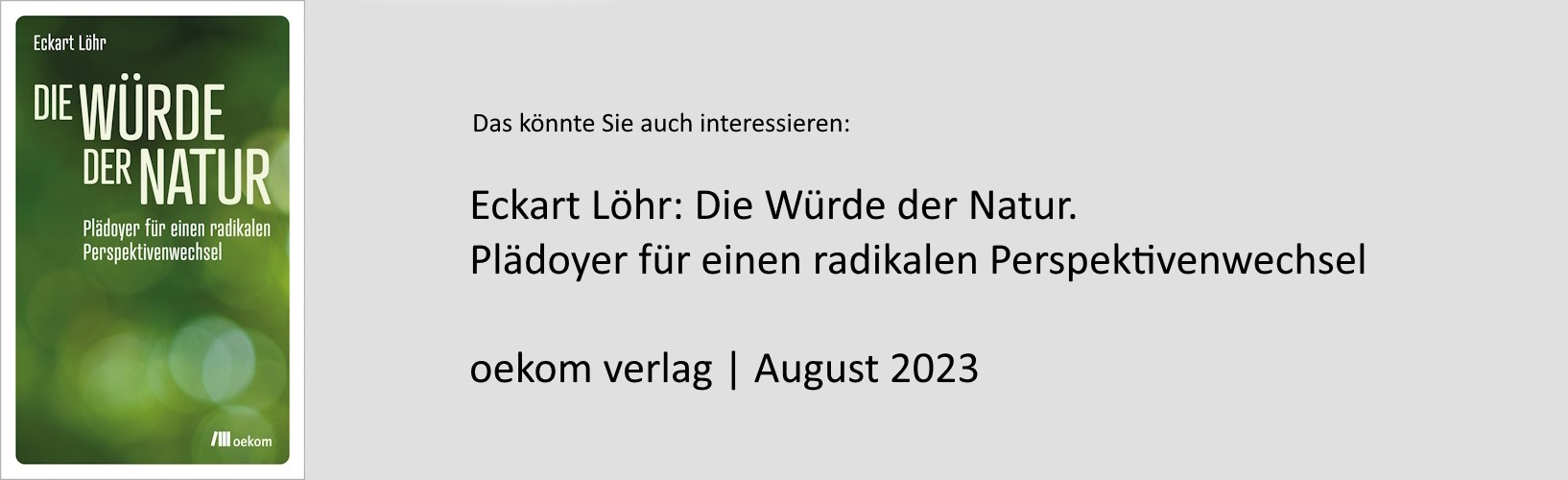Herr Gorke, Sie vertreten eine holistische Umweltethik. Damit nehmen Sie innerhalb der traditionellen Ethik eher eine Randposition ein. Was genau können wir unter holistischer Ethik verstehen?
Seit Umweltethik in den 1970er Jahren als akademische Disziplin entstand, wird dort um die Frage gerungen, welchen Objekten unseres Handelns gegenüber Rücksicht um ihrer selbst willen gebührt. Es werden vier verschiedene Antworten vorgeschlagen: In der anthropozentrischen Ethik können nur Menschen solche direkten Gegenstände von Moral sein, in der pathozentrischen Ethik sind es auch leidensfähige Tiere, in der biozentrischen Ethik alle Lebewesen und in der holistischen Ethik auch das Unbelebte sowie überorganismische Ganzheiten wie Arten, Ökosysteme und der Planet Erde. In einer holistischen Ethik kommt der gesamten Natur ein Eigenwert zu.
Von Wert lässt sich sinnvollerweise doch nur dann sprechen, wenn eine wertgebende Instanz existiert. Die einzige wertgebende Instanz auf diesem Planeten ist der Mensch. Wie lässt sich unter dieser Bedingung der Eigenwert der Natur begründen, ohne am Ende doch wieder auf den Menschen oder eine letzte metaphysische Instanz zurückgreifen zu müssen?
Auch ich betrachte den Eigenwert als eine menschliche Zuschreibung. Aus der Tatsache, dass diese Wertzuweisung von uns Menschen vorgenommen wird, folgt allerdings nicht, dass sie auch nur gegenüber Menschen erfolgen kann. Ein methodischer bzw. erkenntnistheoretischer Anthropozentrismus impliziert keinen ethischen. Anthroponomie und ethischer Holismus schließen sich nicht aus.
Was heißt in diesem Zusammenhang »Anthroponomie« und wo liegt der Unterschied zur »Anthropozentrik«?

Den Begriff Anthroponomie hat Gotthard M. Teutsch in die umweltethische Debatte eingeführt, um die erkenntnistheoretische Anthropozentrik begrifflich klarer von der ethischen Anthropozentrik zu trennen. Erkenntnistheoretische Anthropozentrik oder Anthroponomie bedeutet, dass wir die Dinge dieser Welt grundsätzlich nur aus unserer spezifisch menschlichen Perspektive heraus erkennen und beurteilen können. Ethische Anthropozentrik dagegen bezeichnet die These, dass ausschließlich Menschen einen Eigenwert besitzen und damit direkte Gegenstände von Moral sein können. Nun wird in Diskussionen der Umweltethik und des Naturschutzes die ethische Anthropozentrik immer wieder mit dem Argument gerechtfertigt, Anthropozentrik – und damit ist dann die erkenntnistheoretische gemeint – sei letztlich »unhintergehbar«. Richtig daran ist, dass Anthroponomie tatsächlich unausweichlich ist, doch der Schluss, daraus folge eine ethische Anthropozentrik, ist falsch. Dies lässt sich gut am Beispiel des Tierschutzes zeigen. In nahezu allen modernen Ethiken wird das moralische Verbot, Wirbeltieren unnötigen Schmerz zuzufügen, als eine direkte Pflicht gegenüber den Tieren verstanden, obwohl klar ist, dass sich über das Wohlbefinden von Tieren nur im Rahmen menschlicher Denk- und Bewertungsmöglichkeiten etwas aussagen lässt. Diese Rekonstruktionen fremden Wohls und Wehes anhand von Analogieschlüssen sind zwar zugegebenermaßen stets hypothetisch, doch wenn man sie mit den empirischen Befunden der Naturwissenschaften untermauert, können sie ein hinreichendes Maß an Verlässlichkeit und Objektivität für sich beanspruchen.
Sie schreiben in Ihrem Buch Eigenwert der Natur: »Nicht das universale Moralkonzept des Holismus leidet unter Begründungsnot, sondern all jene Konzepte, die Grenzen der Berücksichtigungswürdigkeit ziehen.« Wie stellt sich aus Ihrer Sicht diese Begründungsnot dar? Wo genau stoßen die traditionellen Ethiken an ihre theoretischen und praktischen Grenzen?
Um die Begründungsnot der traditionellen Ethikkonzepte aufzeigen zu können, muss ich zunächst die beiden Prämissen darlegen, die meiner Begründung einer holistischen Ethik zugrunde liegen. Die erste, normative Prämisse ist die Einnahme des »moralischen Standpunktes«: Man muss sich als moralischer Mensch verstehen wollen, als jemand also, der nicht nur seine eigenen Interessen oder die seiner Beziehungsgruppe durchzusetzen versucht, sondern sich verallgemeinerbaren ethischen Grundsätzen unterwirft.
Analysiert man den moralischen Standpunkt in formaler Hinsicht, wird deutlich, dass Moral ihrem Wesen nach universal ist. Mit »universal« ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass sie sich in irgendeiner Form immer auf »alle« bezieht. Doch »Wer sind ‚alle‘?« (so der Titel eines Aufsatzes des Philosophen Ernst Tugendhat). Wie ich bereits ausgeführt hatte, ist die Antwort auf diese Frage in der Umweltethik umstritten. Für Anthropozentriker lautet die Antwort »alle Menschen«, für Pathozentrikerinnen »alle bewusstseinsfähigen Wesen«, für Biozentriker »alle Lebewesen« und für Holistinnen »alles Seiende«. Wer hat Recht?
Umkehr der Begründungslast
Um sicherzustellen, dass dies möglichst wenig willkürlich entschieden wird, empfiehlt es sich, eine methodische Regel heranzuziehen, die sowohl für die Naturwissenschaften als auch für die moderne Philosophie grundlegend ist: das Prinzip der ontologischen Sparsamkeit (»Ockhams Rasiermesser«). Es stellt die zweite, methodische Prämisse meiner Begründung einer holistischen Ethik dar. Nach dem Prinzip der Sparsamkeit sollte man, wenn zwischen zwei konkurrierenden Begründungen oder Erklärungen keine empirische Entscheidung getroffen werden kann, die einfachere, weniger aufwändige wählen. Sie darf prima facie als die plausiblere gelten. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass dies in erster Näherung für den Verantwortungskreis der holistischen Ethik spricht, denn auf die Frage »Wer sind alle?« liefert diese die einfachste Antwort. »Alle« sind bei ihr schlicht »alle«, das heißt, der universale Charakter von Moral gilt hier unverkürzt. Dagegen sind die Interpretationen, die die anderen Moralkonzepte für den Terminus »alle« vorschlagen, durchweg aufwändiger. Da bei ihnen »alle« jeweils in einem ganz speziellen eingeschränkten Sinne gemeint ist, bedürfen sie im Gegensatz zur holistischen Interpretation einer zusätzlichen Begründung.
Das Prinzip der Sparsamkeit führt bei der Frage nach dem Umfang der Moralgemeinschaft also zu einer Umkehr der Begründungslast: Nicht der Holismus muss begründen, warum er allem Existierenden einen Eigenwert zuschreibt, sondern die eingeschränkten Konzepte haben zu rechtfertigen, warum sie – trotz der Universalität von Moral – bestimmte Entitäten aus der Moralgemeinschaft ausschließen. Nimmt man unser heutiges naturwissenschaftliches Wissen, das Verbot des naturalistischen Fehlschlusses und das Prinzip der ontologischen Sparsamkeit ernst, dürfte diese Rechtfertigung nicht leicht zu erbringen sein. Aufwändige weltanschauliche Prämissen, die Ausschlüsse früher »plausibel« gemacht haben, scheiden im Rahmen einer säkularen Ethik heute jedenfalls aus.
Sie sagen, die holistische Ethik sei die voraussetzungsärmste und damit die am einfachsten zu begründende Ethik. Wenn das so ist, woran liegt es, dass der Holismus bis heute nur von sehr wenigen PhilosophInnen vertreten wird und immer noch eine Außenseiterposition darstellt?
Um dies zu verstehen, muss man die logische Dimension von der geschichtlichen unterscheiden. Moral war während des größten Teils ihrer Geschichte nur sehr eingeschränkt universal. Sie entstand ja in Kleingruppen. Moralische Pflichten galten deshalb zunächst nur gegenüber den Mitgliedern der eigenen Gruppe bzw. gegenüber denjenigen, die man als »seinesgleichen« empfand. Allmählich wuchs dann aber die Einsicht, dass man auch Menschen außerhalb der eigenen Gruppe als seinesgleichen verstehen konnte, ja musste, wenn man nur differenziert genug hinschaute. Es erschien dann mehr und mehr willkürlich, die moralische Achtung gegenüber Anderen von letztlich zufälligen empirischen Merkmalen wie der Sprache, dem Brauchtum, der Religion, der Hautfarbe oder dem Geschlecht abhängig zu machen. Der universale Charakter von Moral brach sich Bahn. Er führte im Laufe der Jahrhunderte zu einer zwar nicht immer kohärenten, aber insgesamt doch kontinuierlichen Ausweitung der Moralgemeinschaft.
Die allumfassende Moral des Holismus
Für die Ethik von größter Bedeutung war dabei zweifellos die allmähliche Einbeziehung der bewusst empfindungsfähigen Tiere in die Moral. Damit war beispielhaft gezeigt, dass es auch gegenüber nichtmenschlichen Naturwesen direkte Pflichten geben kann und sollte. Inzwischen stellt diese sogenannte pathozentrische Position die Mehrheitsmeinung in der Umweltethik dar. Albert Schweitzer ging mit seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben freilich schon vor hundert Jahren darüber hinaus. Die holistische Ethik greift sein Bestreben nach einer allumfassenden Moral auf und vollzieht dabei den letzten Schritt, den man auf dem bisher verfolgten Weg nun noch machen kann: Nicht nur allen Lebewesen, sondern auch der unbelebten Natur sowie überorganismischen Ganzheiten wird ein Eigenwert zugesprochen. Der geschichtliche Prozess eines immer universaleren Verständnisses von Moral erfährt damit seine Vollendung.
Wenn dieser letzte konzeptionelle Schritt sich sowohl historisch als auch logisch gesehen aufzudrängen scheint, warum ist die holistische Ethik dann immer noch eine Minderheitenposition in der Philosophie? Zwei Gründe dürften hierfür ausschlaggebend sein: Zum einen ist es nicht immer leicht, die zahlreichen Gemeinsamkeiten mit anderen Naturwesen ohne vertiefte naturwissenschaftliche Kenntnisse wahrzunehmen und sich von ihnen berühren zu lassen. Je weiter ein Wesen stammesgeschichtlich von uns entfernt ist, desto schwerer fällt es uns, Empathie mit ihm zu empfinden. Dies gilt umso mehr, wenn weltanschauliche Vorurteile hierbei die Sicht trüben oder sie gar ganz versperren. Man denke an Descartes‘ Verständnis von den Tieren als seelenlose Automaten oder die bis heute oft für selbstverständlich gehaltene Vorstellung, die gesamte Natur sei nur dazu da, um den Interessen des Menschen zu dienen. Nicht von ungefähr habe ich vorhin für die Ethik und die von ihr herangezogenen Weltbilder das Prinzip der ontologischen Sparsamkeit angemahnt. Nur auf seiner Grundlage lassen sich weltanschauliche Anmaßungen wie diese stichhaltig kritisieren.
Der Klimaschutz und Fridays for Future
Zum anderen läuft es in der Ethik nicht viel anders als in anderen Disziplinen und gesellschaftlichen Bereichen: Ein etabliertes Paradigma räumt nicht ohne Not das Feld. Zu dem Beharrungsvermögen der traditionellen Ethikkonzepte kommt für den Holismus erschwerend hinzu, dass seine Öffnung der Moralgemeinschaft für die gesamte Natur mit teilweise unbequemen praktischen Konsequenzen verbunden ist. Er fordert dem moralischen Akteur und der moralischen Akteurin ja ab, sich in ihrem Handeln nicht nur zugunsten ihrer Mitmenschen und späterer Generationen, sondern darüber hinaus auch zugunsten aller anderen Naturwesen ein gutes Stück zurückzunehmen. Es wäre verwunderlich, wenn diese Selbstbegrenzung aus moralischer Einsicht überall auf Begeisterung stieße.
Lassen Sie uns von der Theorie zur Praxis kommen. Mit Fridays for Future ist es einer Bewegung gelungen, die Klimakrise ganz oben auf die politische Agenda zu bringen. Allerdings nimmt man von dieser Seite aus in erster Linie die Forderung wahr, auf die Wissenschaften zu hören und den CO2-Ausstoß zu senken. Umweltethisch gesehen scheinen ihre VertreterInnen auf der Ebene der Anthropozentrik steckengeblieben zu sein. Wie stehen Sie selbst zu Fridays for Future und wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten dieser Bewegung ein?
Die Fridays for Future Bewegung und ihre Aktivitäten begrüße ich sehr. Sie sind einer der wenigen Lichtblicke in einer oft von Verdrängung, Gleichgültigkeit und Mutlosigkeit geprägten Klimadebatte. An der Forderung der Bewegung, den CO2-Ausstoß in dem von der Wissenschaft angemahnten Maße zu senken, kann ich nichts Kritikwürdiges erkennen. Ihre Umsetzung ist dringend notwendig. Das Individuum steht auf verlorenem Posten, wenn die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen einem klimaverträglichen Alltagshandeln immer noch in vielfacher Hinsicht entgegenstehen. Was das in Paris vereinbarte Ziel betrifft, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, so lässt sich dieses sowohl mit einer anthropozentrischen als auch mit einer holistischen Ethik gut begründen. Der Klimaschutz ist eines der wenigen Handlungsfelder, in denen Anthropozentrik und Holismus weitgehend zu denselben Konsequenzen führen.
Wenn die Politik aus ihrer Mitverantwortung für die Klimakrise also nicht entlassen werden darf, so gilt dies aus holistischer Sicht genauso für das Individuum. Politische Forderungen und persönliches Umweltverhalten sollten Hand in Hand gehen. Wir alle sind angehalten, den eigenen CO2-Ausstoß den zirka 2,3 t pro Jahr und Person anzunähern, die auf die Weltbevölkerung hochgerechnet noch zulässig wären, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Gegenwärtig beträgt der Durchschnittswert in Deutschland noch um die 11 t. Dabei gilt es die Illusion zu verabschieden, die Herausforderung dieser Reduzierung könne uns die Technik gänzlich abnehmen, etwa durch Effizienzsteigerungen oder durch Innovationen wie das Ersetzen des Verbrennungsmotors durch den Elektroantrieb. So begrüßenswert verbesserte Effizienz auch ist, ohne Suffizienz, also das parallele Zurückfahren der gegenwärtig unverhältnismäßig hohen Konsum- und Mobilitätsansprüche (insbesondere natürlich in den Industrieländern) wird es nicht gehen. Das haben die Analysen zum sogenannten Rebound-Effekt klar gezeigt. Damit ist das Phänomen gemeint, dass Effizienzgewinne infolge technischer Entwicklungen zu einem großen Teil durch Verbrauchssteigerungen wieder aufgefressen werden.
Hoffnung ist moralische Pflicht
Sie fragen, wie ich die Erfolgsaussichten der Klimabewegung angesichts der immensen politischen und persönlichen Herausforderungen einschätze. Immer wenn ich Gefahr laufe, hier die Hoffnung zu verlieren, rufe ich mir eine begriffliche Analyse des Sozialpsychologen Erich Fromm ins Gedächtnis. Er hat darauf hingewiesen, dass wir bei existenziellen Bedrohungen, wenn uns das Bedrohte am Herzen liegt, normalerweise nicht nach der Wahrscheinlichkeit eines Ausweges fragen, sondern nach seiner realen Möglichkeit. Nehmen wir als Beispiel einen Arzt, der einen schwerverletzten Patienten zu versorgen hat. Er wird vor der Operation nicht fragen, ob man mit dem Überleben des Patienten rechnen könne, sondern ihn interessiert allein, ob dessen Rettung auf der Grundlage der Fakten noch möglich ist. Auch wenn er weiß, dass die Chancen dafür statistisch gesehen äußerst gering sind, wird er bei der Operation sein Bestes geben. Entsprechendes muss für die Klimakrise gelten. Hier sagen uns die Forscher ja, dass es mit sehr großen Anstrengungen durchaus noch möglich ist, das 2-Grad-Ziel zu schaffen. Also sollten wir uns nicht lange mit Spekulationen über die Erfolgsaussichten der Klimabewegung aufhalten, sondern zusammen mit ihr alles tun, um die uns noch gegebene Restchance zu wahren. Hoffnung ist hier moralische Pflicht.
Welche Funktion kann Umweltethik überhaupt noch haben in einem hyperkonsumtiven, auf dem Raubbau der Natur gegründeten Wirtschaftssystem, in dem es ausschließlich um Kapitalinteressen geht, die zum Teil mit brutaler Macht verfolgt und umgesetzt werden? Oder anders gefragt: Welche Chancen räumen Sie der holistischen Ethik ein, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten vom philosophischen Rand in das Zentrum der Diskussion zu rücken und auch wirklich praktisch wirksam zu werden?
Gut, dass Sie diese Frage stellen, denn sie gibt mir die Gelegenheit, ein verbreitetes Missverständnis über Ethik auszuräumen. Anders als vielfach angenommen ist Ethik keine instrumentelle Disziplin, die, wie beispielsweise die Medizin oder die Ingenieurwissenschaften, die primäre Aufgabe hat vorgegebene Ziele zu erreichen. Sie ist hingegen diejenige Disziplin, die diese Ziele zu bewerten und diese Bewertungen zu begründen hat. Sicherlich muss Ethik darüber hinaus immer auch an der Umsetzung ihrer Reflexionen und der Vermittlung eines entsprechenden Ethos interessiert sein. Doch die Verwirklichung dieses Bestrebens ist keineswegs auf ihren Zuständigkeitsbereich beschränkt. Psychologie, Pädagogik, Publizistik, Politik und Ökonomie sind hier ebenso gefordert. Oft sind ihre Instrumentarien wirksamer und motivationsstärker als »reine Argumente«. Umweltethik und die genannten Disziplinen müssen deshalb zusammenarbeiten. Um es am Beispiel eines Segelschiffes zu veranschaulichen, kommt der Ethik dabei primär die Rolle des Steuerruders zu. Sie sagt uns – in letzter Instanz -, wohin es gehen soll und warum. Damit das Schiff den Kurs aufnehmen kann, bedarf es aber auch der Segel, also gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, die über die ethischen Argumente hinaus das Individuum befähigen und motivieren, das als richtig Erkannte auch zu tun. Um dies leisten zu können, müssen die Segel freilich richtig gesetzt sein, sonst kann auch das beste Steuerruder nicht verhindern, dass das Schiff den Kurs verfehlt.
Das Ziel ist eine »Postwachstumsökonomie«
Nun haben Sie hier nicht von ungefähr die Rolle der Wirtschaft angesprochen. Diese ist ohne Frage eines der wirkmächtigsten Segel und derzeit ganz gewiss nicht so »gesetzt«, dass sie den Kurs des Steuerruders unterstützt. Im Gegenteil steht das gegenwärtige kapitalistische System mit seiner Zelebrierung des Konsums und seinem inhärenten Zwang zum Wachstum den ökologischen und ethischen Erfordernissen diametral entgegen. Aus Sicht einer holistischen Ethik ist ein Paradigmenwechsel hin zu einer »Postwachstumsökonomie« unabdingbar. Warum dies so ist und wie solch ein alternatives Konzept aussehen könnte, hat der Ökonom Nico Paech in seinem Buch Befreiung vom Überfluss ausgeführt. Der Titel des Buches bringt dabei zum Ausdruck, dass die notwendige Transformation nicht ausschließlich mit Verzicht assoziiert werden sollte – obwohl sie diesen zweifellos beinhaltet -, sondern dass sie das Leben insgesamt reicher, tiefer und selbstbestimmter machen kann.
Sie haben davon gesprochen, dass wir unseren individuellen CO2-Ausstoß von 11 t auf 2,3 t senken müssen. Innerhalb dieses Systems ist das natürlich völlig illusorisch. Gegen eine andere Form des Wirtschaftens gibt es aber massive Widerstände von Seiten der Politik, der Wirtschaft und großer Teile der Bevölkerung. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von Paradigmenwechsel. Ist es nicht in Wahrheit so, dass wir sowohl eine kulturelle als auch eine wirtschaftliche und ökologische Revolution brauchen? Und wo sehen Sie das gesellschaftliche Subjekt, dass diese radikalen Veränderungen anstoßen könnte?
Den Paradigmenbegriff habe ich verwendet, weil es im vorliegenden Zusammenhang zunächst um den Austausch eines wissenschaftlichen Weltbildes durch ein anderes ging. Sie haben aber natürlich Recht, dass der Paradigmenwechsel in der Ökonomie eine ganze Reihe anderer, tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen sowohl voraussetzen als auch nach sich ziehen würde. Man kann das »Revolution« nennen, doch wäre ich mit der prospektiven Verwendung dieses Begriffes vorsichtig, da er leicht mit Umsturz und Gewalt assoziiert werden kann und dann von den notwendigen Veränderungen abschreckt. Eher sollte man darauf hinweisen, dass diese Veränderungen jetzt noch ohne Gewalt und massive Verwerfungen erfolgen könnten, nicht mehr aber, wenn der Klimaschutz weiterhin auf die lange Bank geschoben wird und sich das Fenster für das 2-Grad Ziel geschlossen hat. Dann werden die Folgen der Erderhitzung den Wandel erzwingen und zwar ohne Rücksicht auf Verluste.
Sie fragen nun nach dem »gesellschaftlichen Subjekt«, das die erforderlichen Veränderungen anstoßen könnte. Das kann niemand anderes sein als wir selbst. Um die Verantwortung des Individuums führt kein Weg herum. Wie schon gesagt gilt es diese Verantwortung auf zwei Ebenen wahrzunehmen: der Ebene des Alltagshandelns und der des politisch-gesellschaftlichen Handelns, also durch Mitwirkung in Institutionen, Organisationen und Bewegungen und nicht zuletzt durch das persönliche Wahlverhalten. Dass das Individuum hierbei keineswegs ohnmächtig zu bleiben braucht, hat die Bewegung Fridays for Future eindrucksvoll gezeigt. Insbesondere gibt ihr Beispiel Anlass zu der Hoffnung, dass es nicht nur in natürlichen, sondern auch in sozialen Systemen nicht-lineare Dynamiken gibt, Systemprozesse also, die sich aufgrund von positiven Rückkoppelungen lawinenartig verstärken und so plötzlich zu völlig neuen Entwicklungen führen. Die Tatsache, dass diese prinzipiell nicht vorhersagbar sind, sollte für uns ein Grund mehr sein, die Flinte nicht vorschnell ins Korn zu werfen.
In dem Buch Alles könnte anders sein des Soziologen Harald Welzer schreiben die beiden Autorinnen Magali Mohr und Gemina Picht in ihrem Gastbeitrag, dass wir »die Produktivkraft Träumen ruiniert« hätten. »Man könne das zivilisatorische Projekt der Moderne aber nicht fortsetzen, ohne die Idee von einer Zukunft zu haben, die ein besseres Leben vorsieht als das, das heute zu haben ist.« Wie sieht Ihr Traum der Zukunft aus? Und was bedeutet für Sie das »bessere Leben«?
Auch wenn ich den Wunsch der beiden Autorinnen verstehen kann, den Umweltdiskurs nicht mehr wie bisher nur mit dem erhobenen Zeigefinger und Kassandrarufen, sondern mit Visionen vom besseren Leben zu führen, verspüre ich aus drei Gründen wenig Neigung, mich daran in größerem Umfang zu beteiligen. Der erste, strukturelle Grund ist, dass Fragen des guten Lebens argumentativ nur wenig hergeben, denn sie sind meistens nur schwer verallgemeinerbar. Wenn ich meiner Kollegin erzähle, wie schön es doch jeden Morgen ist, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, so muss ich damit rechnen, dass sie mir antwortet, mit ihrem SUV sei es aber doch viel schöner. Es dürfte schwierig sein, ihre Vorstellung von einem guten Leben ohne Zuhilfenahme sehr anspruchsvoller anthropologischer Prämissen als an sich schlechter zu qualifizieren als die meine. Sehr wohl kann ich aber ihre Vorstellung im Hinblick auf deren Folgen kritisieren: Es gibt kein Recht auf eine Mobilitätsform, die das Klima und das Leben anderer nachweislich überproportional schädigt. Mit diesem verallgemeinerbaren ethischen Argument bin ich allerdings wieder bei der negativen Darstellungsform angelangt, die viele im Umweltdiskurs offenbar gerne hinter sich lassen würden.
Uns Schritt für Schritt der Wahrheit nähern
Dass dies nicht nur wenig hilfreich, sondern auch nicht ratsam wäre, stellt meinen zweiten, erkenntnistheoretischen Einwand gegen ein Primat der positiven gegenüber der negativen Argumentation dar. Er fußt auf der Einsicht des Philosophen Karl Popper, dass wir weder »die Wahrheit« in der Wissenschaft noch »das Gute« in gesellschaftlicher Hinsicht direkt, das heißt mit definitiver Gewissheit, erkennen können. Wir können uns diesen beiden »regulativen Ideen« aber immerhin auf indirekte Weise annähern, indem wir Irrtümer und Fehlurteile bei unseren bisherigen Annahmen aufdecken und diese sukzessive korrigieren. Dies erfolgt zwangsläufig negativ, nämlich über Kritik. Dabei ist es die Stärke eines solchen Schritt-für-Schritt-Verfahrens, dass es der menschlichen Irrtumsfähigkeit und Fehlbarkeit strukturell Rechnung trägt. Insofern ist es bescheidener und »fehlerfreundlicher« als der große positive Entwurf. Vorausgesetzt wir wissen die ungefähre Richtung – und hier hat uns der Kompass Ethik zu leiten -, dann können wir nach jedem Schritt überlegen, ob der Weg und die Geschwindigkeit noch stimmen, und aus der neuen Perspektive weitere begründete Entscheidungen treffen. Sicherlich, Träume und Utopien mögen mehr Strahlkraft haben. Aber wenn ihre Prämissen daneben liegen – und das war in der Geschichte der Menschheit nur allzu oft der Fall – werden sie leicht zum Alptraum.
Dies führt zu meinem dritten, ethischen Grund, warum ich das angeführte Zitat kritisch sehe. Seine These, wir sollten »das zivilisatorische Projekt der Moderne« mit einer Idee von Zukunft fortsetzen, »die ein besseres Leben vorsieht als das, das heute zu haben ist«, klingt in meinen Ohren recht anthropozentrisch: Als ob der Planet Erde und alle seine nichtmenschlichen Bewohner nur darauf warten würden, unsere Träume und Wünsche zu erfüllen! Die holistische Umweltethik sieht das fundamental anders. Da hier allen Naturwesen und Gesamtsystemen ein Wert an sich zukommt, sollten wir zunächst einmal darum bemüht sein, sie so wenig wie möglich zu instrumentalisieren. Und wo wir Tiere, Pflanzen und ganze Ökosysteme dennoch instrumentalisieren, weil wir dies aus existenziellen Gründen müssen oder aber zur kulturellen Bereicherung unseres Daseins wünschen, sollten wir dies nach universalen ethischen Maßstäben tun. Insbesondere die bereits im zwischenmenschlichen Bereich gut etablierten Prinzipien der Verhältnismäßigkeit, der Verteilungsgerechtigkeit und des kleinsten moralischen Übels scheinen hier tragfähig zu sein. In meinem Buch Eigenwert der Natur habe ich ausgeführt, was aus ihnen für den Umgang mit der außermenschlichen Natur folgt. Nehmen Sie die Hoffnung, dass eine solche holistische Perspektive sich im Denken und Handeln der Menschen mehr und mehr durchsetzt, als meinen »Traum der Zukunft«.
Das Interview entstand in der Zeit vom 20.11.2019 bis 11.3.2020 per Mail. Foto: Till Junker
Martin Gorke, 1958 in Stuttgart geboren, gilt als einer der führenden Vertreter einer holistischen Umweltethik.
Martin Gorke studierte Biologie und Philosophie in Bochum und Bayreuth. Von 1985 bis 1993 arbeitete er als Naturschutzwart auf der Vogelhallig Norderoog im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. 1989 Promotion im Fach Tierökologie. 1997 Promotion im Fach Philosophie mit einer Dissertation über die ethische Dimension des Artensterbens. Von 1997 bis 2002 war Martin Gorke wissenschaftlicher Assistent an der Professur für Umweltethik der Universität Greifswald. 2008 Habilitation im Fach Umweltethik mit dem Thema Eigenwert der Natur. Ethische Begründung und Konsequenzen. Seit 2016 ist Martin Gorke Professor für Umweltethik an der Universität Greifswald.
Publikationen (Auswahl): Artenschutz und Tierschutz: Gegner oder Verbündete? TIERethik 7(11) 2015/2: 23-45; Eigenwert der Natur. Ethische Begründung und Konsequenzen (2010); The Death of Our Planet`s Species. A Challenge to Ecology and Ethics (2003); Spektrum der Umweltethik. Hrsg. mit K. Ott (2000); Artensterben. Von der ökologischen Theorie zum Eigenwert der Natur (1999).