Seit dem Versanden der globalisierungskritischen Bewegung und nachdem sich Occupy Wallstreet als Strohfeuer erwiesen hat, ist es um die mehr oder weniger radikale Kritik des gegenwärtigen Kapitalismus etwas still geworden. Die neueste Linke etwa in den Vereinigten Staaten scheint sich derzeit eher an anderen Unerfreulichkeiten abzuarbeiten, wie der rassistischen Diskriminierung von People of Color, dem Sexismus gegenüber Frauen und der Abwertung minoritärer Sexualitäten und abweichender geschlechtlicher Identitäten. Spätestens mit dem Sieg Donald Trumps bei den letzten amerikanischen Präsidentschaftswahlen ist das Aufkommen einer neuen Form des Autoritarismus evident geworden. Seither gilt offensichtlich zudem die Devise: „We’ve got a bigger problem now“. Das diffuse Unbehagen der westlichen Mittel- und Unterschicht im neoliberalen globalisierten Kapitalismus der Gegenwart, das sich jüngst etwa in der Revolte der Gilets Jaunes in Frankreich eruptiv bemerkbar gemacht hat, hat bislang kaum seinen theoretischen Ausdruck gefunden.
Rendueles zeigt die Schattenseiten des Kapitalismus
In den südeuropäischen Ländern, wo die sozialen Verwerfungen in Folge der jüngsten ökonomischen Krise nach wie vor spürbar sind, scheint momentan ein ausgeprägteres Interesse an kapitalismuskritischer Theorie zu bestehen als anderswo. Der spanische Autor, Soziologe und Vordenker von Podemos, César Rendueles, hat nun mit Kanaillen-Kapitalismus – Eine literarische Reise durch die Geschichte der freien Marktwirtschaft eine essayistische Phänomenologie des Kapitalismus vorgelegt, die durchaus nicht mit Kritik an den Härten des ökonomischen Systems geizt, das im Allgemeinen als alternativlos angesehen wird. Das Werk verbindet Ausführungen zur Genese und Geschichte der kapitalistischen Wirtschaftsweise mit Zeitdiagnostik und lädt gleichzeitig dazu ein, eine Vielzahl von literarischen Werken zu entdecken, in denen ökonomische, soziale und politische Krisen und Krisenerfahrungen ihre Spuren hinterlassen haben.
Rendueles versucht, die historischen Linien der kapitalistischen Entwicklung nachzuzeichnen: Von den Anfängen des Kapitalismus und der repressiven Durchsetzung der neu aufkommenden Wirtschaftsweise, über die Sklaverei und den Kolonialismus, die beiden Weltkriege, die Soziopathologien der Zwischenkriegszeit in der ersten Hälfte des kurzen 20. Jahrhunderts, den Ausbau des Wohlfahrtsstaats nach 1945 bis zur neoliberalen „Konterrevolution“ ab Mitte der 70er Jahre. Dabei konzentriert er sich vor allem auf ihre verdrängten Schattenseiten. Das Bild, das hier gezeichnet wird, ist nicht sehr ausgewogen. Es ist ein schwarzes Bild. Die Geschichte der freien Marktwirtschaft erscheint unter diesem Blick als eine Geschichte der Ausbeutung, der Armut, der Ohnmacht, der Unfreiheit, der Gewalt und der Zerstörung, und der Kapitalismus als eine historische Gesellschaftsformation, die immer wieder von Perioden der „Sozioporose“ heimgesucht wird.
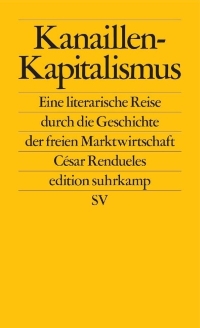
Das Buch ist keine systematische theoretische Abhandlung. Zahlreiche Bezüge zu sozialwissenschaftlichen Schriften und literarischen Werken (etwa Romane von Daniel Defoes Robinson Crusoe bis zu Bret Easton Ellis American Psycho) und Verweise auf Phänomene der Populärkultur wie die Fernsehserie The Simpsons finden sich im Text. Daneben sind soziologische Betrachtungen, Alltagsbeobachtungen, historische Anekdoten und Autobiographisches eingestreut. Explizit will der Autor das versammelte Material nicht im Sinne eines Kanons, der das Thema erschöpfend abbildet, verstanden wissen. Vielmehr sollen die eigenen disparaten Rezeptionserfahrungen als Reservoir für die Reflexion des Gegenstands, als Ausgangspunkte eines assoziativen Streifzugs durch die Geschichte des Kapitalismus, dienen. Vieles bleibt kursorisch, bloß vage angedeutet. Argumentationsfiguren blitzen wie Schlaglichter auf. Die Leser*innen sind gefordert, aus dem Angeführten selbstständig weitere kritische Funken zu schlagen. Das Ganze liest sich deshalb über weite Strecken sehr unterhaltsam und man muss Rendueles dafür loben, dass er auf den üblichen Jargon verzichtet. Mitunter ist die Lektüre aber auch etwas ermüdend, wenn sich etwa an die Schilderung einer Begebenheit aus dem Leben des Autors keine nennenswerte Reflexion anschließt.
Rendueles hat eine spanischsprachige Ausgabe von Das Kapital von Karl Marx herausgegeben. Stellenweise liest sich Kanaillen-Kapitalismus dann auch wie eine Illustration Marxscher Grundbegriffe durch literarische Zitate – ohne diese Begriffe freilich explizit zu nennen. Marx, dessen Werk mit literarischen Anspielungen gespickt ist, hätte das sicher gefallen. Zum Widerspruch zwischen bürgerlicher Freiheit und der „Despotie der Fabrik“ (Karl Marx) bemerkt Rendueles: „Es bleibt irritierend, dass wir am Arbeitsplatz, wo wir einen großen Teil unserer Zeit verbringen, Formen der Unterordnung akzeptieren, die wir in jedem anderen Bereich unseres Lebens als abstoßend empfinden würden“. Die Atmosphäre in einer fordistischen Autofabrik wird durch ein Zitat aus Louis-Ferdinand Célines Reise ans Ende der Nacht plastisch. Die große Einhegung der Allmenden im Zuge der „ursprünglichen Akkumulation des Kapitals“ (Karl Marx) wird bebildert durch Passagen aus Die weiße Rose von B. Traven, in denen geschildert wird, wie eine indigene bäuerliche Gemeinschaft im Mexiko des frühen 20. Jahrhunderts ihr Gemeindeland an eine mächtige amerikanische Ölgesellschaft verliert. Es wird dabei deutlich, dass sich solche Prozesse der Enteignung, Proletarisierung und Inwertsetzung nicht ausschließlich auf die historische Geburtsstunde des Kapitalismus beschränken, sondern sich im weiteren Verlauf der Durchsetzungsgeschichte dieser ökonomischen Formation permanent wiederholen.
Der historische Scheideprozess von Produzent*innen und Subsistenzmitteln wird auch anhand einer Stelle aus Oliver Twist von Charles Dickens vor Augen geführt:
„Die Mitglieder des Gemeinderats waren sehr weise, einsichtsvolle, philosophische Männer. Als sie ihre Aufmerksamkeit dem Armenhaus zuwandten, fanden sie mit einem Male, was bisher noch kein gewöhnlicher Sterblicher entdeckt hatte, daß es den Armen darin zu gut gefiel. Es war in ihren Augen ein rechtes Vergnügungslokal für die besitzlosen Klassen, ein Wirtshaus, wo nicht bezahlt wurde, jahrein, jahraus Frühstück, Mittagessen, Tee und Abendbrot auf öffentliche Kosten, ein Elysium aus Backsteinen und Mörtel mit Spiel und Tanz, ohne jede Arbeit. „Oho“, sagten die Gemeinderäte, „das muß anders werden, und zwar sofort.“ Sie setzten daher als Richtlinie fest, daß die armen Leute die Wahl haben sollten (denn es war nicht ihre Absicht, jemand zu zwingen), in dem Hause langsam oder außer dem Haus schnell Hungers zu sterben.“
Man sieht: vieles hat sich seit Dickens Zeiten nicht geändert. Die Architekt*innen des aktivierenden Sozialstaats haben jedenfalls historische Vorbilder. Das publizistische Begleitfeuer der „Agenda2010“-Reformen wurde von der Bild-Zeitung mit dem Skandal um den vorgeblich glücklichen Arbeitslosen „Florida-Rolf“ eingeläutet. Jeremy Benthams Behauptung, „dass in einer freien Nation, wo Sklaven nicht erlaubt sind, der sicherste Reichtum in einer großen Zahl arbeitender Armer besteht“ ist wieder handlungsanleitend, wie die Diskussionen im Zuge der Einführung von „Hartz4“ und der politischen Förderung eines Niedriglohnsektors gezeigt haben. Auch wenn diese Maßnahmen neben allerlei „Standort Deutschland“-Geklingel zusätzlich diskursiv durch den Verweis auf die Ermöglichung von Chancen für Geringqualifizierte verbrämt wurden.
„Emanzipation kann nur durch ein Projekt der Neuschöpfung entstehen“
Heinrich von Kleists früher Wutbürger Michael Kohlhaas, für Rendueles der „Prototyp des rebellischen Restaurationisten“, kann in seinem sehr deutschen und sehr protestantischen Furor selbstverständlich kein Modell für den Widerstand gegen die Unzumutbarkeiten der Gegenwart sein: „Es gibt kein zurück mehr. Einmal im Kapitalismus angelangt, kann Emanzipation nur durch ein Projekt der Neuschöpfung entstehen“. Wer wie Kohlhaas oder sein Wiedergänger John Rambo „die Ordnung der Welt wiederherzustellen versucht, nachdem Unrecht deren Sinn tödlich verletzt hat“ sei zum Scheitern verurteilt und ist, so möchte man hinzufügen, dazu verdammt zum Mittel blinder, begriffsloser Gewalt zu greifen.
Potenziale des Widerstands werden von Rendueles vor allem zunächst im Alltagshandeln ausgemacht. Das heißt konkret im Beharren auf Verhaltensweisen und der Pflege von Sozialbeziehungen, auch wenn diese den Imperativen der neoliberalen Selbstoptimierung entgegenstehen.
„Nichts ist für den postmodernen Kapitalismus – diesen ökonomischen Strudel, der uns zwingt, jede familiäre, moralische, ästhetische oder politische Schranke niederzureißen – so subversiv und abstoßend wie die Versuche, neue gesellschaftliche Entwürfe auf der Grundlage dessen zu errichten, was wir sind und immer schon waren: Kinder, Mütter, Geliebte, Nachbarn, Freunde, Genossen … Aus ethischen Prinzipien auf eine Beförderung verzichten, einen Arbeitskollegen solidarisch unterstützen oder nicht irgendwohin umziehen, nur weil es der Arbeitsmarkt befiehlt – das alles stellt für die Apostel der Gewinnmargen eine unerträgliche Glaubensabweichung dar“.
Die Unterstützung durch Freund*innen und die Familie ist für viele in Spanien bittere Notwendigkeit und hilft, ebenso wie solidarische Unterstützung durch Nachbar*innen und im Stadtviertel, wenn jemand damit bedroht ist, seine Wohnung zu verlieren, die gröbsten Krisenfolgen abzumildern.
Rendueles bleibt überzeugende Antworten schuldig
Auffällig ist vor allem die abgeklärte Nüchternheit Rendueles, die etwa auch Angela Nagle, Autorin von Kill All Normies: Online Cultre Wars from 4chan and tumblr to Trump and the Alt-Right, auszeichnet. Nagle hat kürzlich wieder in einem Zeitungsinterview ihrer Überzeugung Ausdruck verliehen, dass „die Rettung nicht aus obskuren Subkulturen kommen wird“. Rendueles sieht dies ähnlich. Der Wunsch nach Veränderung speist sich auch für ihn weniger aus einem transgressiven Begehren, sondern vor allem aus der Hoffnung auf eine Normalität, die etwa für viele jüngere Menschen in den krisengeschüttelten südeuropäischen Ländern unerreichbar erscheint:
„Der Versuch, ein ganz normales Leben zu führen, hat sich in ein gegenkulturelles Experiment verwandelt. Sich um die Menschen kümmern, die wir lieben, einen Beruf erlernen, von unserer Umgebung respektiert werden, in dem Viertel leben, in dem wir aufgewachsen sind, zu aufgeklärten Bürgern werden, das studieren, wozu wir begabt sind, öffentlichen Institutionen vertrauen und die Möglichkeiten haben, sich an ihnen zu beteiligen … Wir stellten fest, dass all das nur geht, wenn wir die uns bekannte Welt auf den Kopf stellen“.
Das kann man spießig finden oder eben einfach nur erwachsen.
Die ganz großen überzeugenden Antworten auf die Frage, wie das intendierte emanzipative „Projekt der Neuschöpfung“ angegangen werden könnte, bleibt Rendueles schuldig. Aber vielleicht liegt in seiner Betonung des Eigensinns lebensweltlicher Vollzüge wenigstens eine der Quellen, aus denen sich auch eine Immunität gegenüber den „autoritären Versuchungen“ (Wilhelm Heitmeyer) der Gegenwart speisen könnte. Eventuell eröffnet sich ja auf diese Weise eine Möglichkeit, der in Folge der letzten Finanzkrise überall mit Händen zu greifenden politischen Depravation etwas entgegensetzen zu können. In eine ähnliche Richtung weisen Überlegungen der französischen anarchistischen Theoretikerin und christlichen Mystikerin Simone Weil, die freilich unter anderen historischen Umständen angestellt wurden. Zur Zeit der großen Weltwirtschaftskrise in den frühen 1930er Jahren hat diese auf ihren Reisen durch das präfaschistische Deutschland die Beobachtung gemacht, dass ein Teil der arbeitslosen deutschen Jungarbeiter*innen für die nationalsozialistische Agitation unempfänglich blieb, gerade weil es ihnen gelungen war, trotz widrigster ökonomischer Umstände „ein menschliches Leben zu verwirklichen“.
Damit ökonomische Perspektivlosigkeit auf der subjektiven Ebene nicht in Apathie, Depression und das Bedürfnis nach autoritären Scheinlösungen umschlägt, müssen die eigenen Erfahrungen ins Bewusstsein gehoben und das Elend auf den Begriff gebracht werden. Rendueles leistet dazu in Kanaillen-Kapitalismus einen Beitrag. Auch wenn er den Leser*innen selbstverständlich keinen ausgereiften Masterplan anbietet, wie der Misere beizukommen wäre, hilft das vorliegende Buch sicher mit, die Voraussetzungen für politisches Handeln zu bereiten.
César Rendueles: Kanaillen-Kapitalismus. Eine literarische Reise durch die Geschichte der freien Marktwirtschaft. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 265 Seiten, 18 Euro





